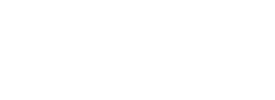Zusammenfassungen und Abstracts
Zusammenfassungen und Abstracts des laufenden Jahres:
Heft 2 - 2023
Testfall Armut. Zum Zusammenhang von Ungleichheitseinstellungen und sozialer Lage
Julian Heide
KZfSS 75, 2023: 117-142
Zusammenfassung: In zeitdiagnostischen Arbeiten wird häufig vermutet, dass sich kosmopolitische Einstellungskomplexe in oberen sozialen Lagen finden, wohingegen untere soziale Lagen durch kommunitaristische Werthaltungen gekennzeichnet sind. Dieser Beitrag nimmt die Armutspopulation als unterstes Segment des sozialen Stratifikationsgefüges in den Blick, um am Testfall dieser Gruppe Einstellungen zu verschiedenen sozialen Ungleichheiten zu untersuchen. Drei gesellschaftlich umstrittene Felder sozialer Ungleichheit, nämlich sexuelle Diversität, Migration und soziale Sicherung, werden in einen Analysezusammenhang integriert. Mit Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) kann gezeigt werden, dass Menschen in Armut gegenüber Homosexuellen oder transgender Personen nicht skeptischer eingestellt sind als nichtarme Personen. Dagegen lehnen Menschen mit Armutserfahrung Migrationsbewegungen eher ab. Die Migrationsskepsis unter Personen in langanhaltender und intensiver Armut ist größer als bei Menschen mit diskontinuierlichen Armutsverläufen. Im Feld der sozialen Sicherung bevorzugen Personen mit Armutserfahrung staatliche Sicherungsmaßnahmen gegenüber privater Absicherung. Der Testfall der Armen zeigt, dass man nicht pauschal von Einstellungskomplexen in einzelnen sozialen Lagen ausgehen kann, vielmehr müssen Einstellungsfelder differenziert betrachtet werden.
Schlüsselwörter: Polarisierung · SOEP · Migration · Diversität · Sozialpolitische Einstellungen
Geschlechtsunterschiede im Wahlverhalten bei Bundestagswahlen der letzten sieben Jahrzehnte
Ansgar Hudde
KZfSS 75, 2023: 143-170
Zusammenfassung: Dieser Beitrag untersucht Geschlechterunterschiede im Wahlverhalten anhand einer weltweit einzigartigen Datenquelle: Informationen aus repräsentativ ausgewählten, abgegebenen Stimmzetteln bei deutschen Bundestagswahlen. Informationen über das tatsächliche Wahlverhalten bieten drei Vorteile gegenüber Umfragedaten: (1) keine Verzerrungen durch soziale Erwünschtheit oder mangelnde Repräsentativität, (2) präzise Messungen durch eine sehr große Stichprobe sowie (3) eine lange Zeitreihe seit 1953. Ich untersuche Veränderungen in den Wahlmustern auf Parteiebene, auf Aggregatsebene und differenziere nach Altersgruppen. Die Ergebnisse zeigen, dass der moderne Gender Gap – Frauen wählen linkere Parteien als Männer – in Deutschland erstmals bei der Wahl 2017 auftrat. Vor dem Hintergrund bisheriger internationaler Forschung ist dies überraschend spät. Die Geschwindigkeit und das Muster der Veränderung legen nahe, dass es sich eher um Perioden- als um Kohorteneffekte handelt. Der moderne Gender Gap variiert nach Alter und ist heute in den jüngeren Altersgruppen am größten. Noch nie gab es in der Bundesrepublik so große Geschlechterunterschiede beim Wahlverhalten wie 2021 bei den 18- bis 24-Jährigen. Die Ergebnisse stehen teilweise im Gegensatz zu früheren, umfragebasierten Studien. Um herauszufinden, ob dieser Kontrast auf die kleineren Stichprobengrößen früherer Studien oder auf geschlechtsspezifische Verzerrungen bei Umfragen zurückzuführen ist (z. B. eine stärkere Verzerrung durch soziale Erwünschtheit bei Frauen), vergleiche ich die Ergebnisse von echten Stimmzetteln mit Umfragedaten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass große Umfragen ausreichend verlässliche Schätzungen für aggregierte Maße liefern, den Gender Gap aber für radikalere Parteien, wie die AfD, teils überschätzen.
Schlüsselwörter: Politische Soziologie · Modern Gender Gap · Umfrageforschung · Soziale Erwünschtheit · Repräsentative Wahlstatistik
Säkularität im Schwimmbad. Einstellungen zu eigene und fremden Körperpraktiken
Ines Michalowski
KZfSS 75, 2023: 171-201
Zusammenfassung: Die Studie untersucht die Aushandlung von Säkularität in öffentlichen Organisationen anhand des Beispiels von Körperpraktiken im Schwimmbad. Gefragt wird, inwiefern es durch das Aufkommen des Burkinis zu einer Neuaushandlung der Rolle von Religion im eigentlich als komplett säkular wahrgenommenen Schwimmbad kommt. Analysiert werden 101 kurze Interviews mit Badegästen im Schwimmbad. Die Datenanalyse zeigt, dass eigene Körperpraktiken vor allem mit Verweis auf Einhaltung der Mehrheitsnorm legitimiert werden. Bei Abweichung von der Norm kommen funktionale und teils wertebezogene Argumente zum Tragen. Die Befürwortung fremder Körperpraktiken, die sich wie beispielsweise der Burkini von den eigenen unterscheiden, wird aber anders, nämlich unter Bezug auf höhere Werte wie Diversität oder Selbstbestimmung legitimiert. Ein mit eigenen Erfahrungen verbundenes Nachempfinden religiös motivierter Körperscham konnte unter den hier befragten nichtmuslimischen Personen nicht beobachtet werden. Theoretisch liefert der Aufsatz einen Beitrag zu der Literatur über das Verhältnis zwischen säkularem und religiösem Körper, indem er verdeutlicht, dass die wahrgenommene Irrationalität religiös genormter Körperpraktiken nicht durch Verständnis, sondern durch wertebasierte Toleranz bearbeitet wird. Die Studie diskutiert zudem die Rolle von Organisationsregeln für die Ermöglichung religiöser Körperpraktiken sowohl hinsichtlich ihrer Fähigkeiten als auch Grenzen, die vor allem in den Reaktionen der Nutzerschaft begründet liegen.
Schlüsselwörter: Burkini · Religion · Islam · Einstellungen · Deutschland
Sterben braucht Latenz. Organisierte Sterbebegleitung im Spannungsfeld von Handeln und Erleben
Armin Nassehi · Irmhild Saake · Niklas Barth · Katharina Mayr
KZfSS 75, 2023: 203-233
Zusammenfassung: In soziologischen Studien über Hospize und Palliativstationen wird häufig kritisiert, dass die Organisationsförmigkeit solcher Einrichtungen das Erleben der Sterbenden überformt. Anhand von problemzentrierten Experteninterviews mit Ärzten und Ärztinnen, Pflegefachkräften sowie narrativen Interviews mit Sterbenden wird in dieser Studie untersucht, nach welchen Kriterien alle Beteiligten Handlungs- und Erlebensmöglichkeiten des Sterbens sich und anderen zurechnen. Auf diese Weise können wir zeigen, dass Sterbeverläufe von professionellen Akteuren als „gut“ erlebt werden, wenn sie als gemeinsames Erleben von einerseits professionellen Akteuren und andererseits Sterbenden, die es so gewollt haben, gedeutet werden können. Dies ist bemerkenswert vor dem Hintergrund eines weiteren Befundes dieser Studie, nämlich der systematischen Perspektivendifferenzen im Erleben des Sterbeverlaufs zwischen professionellen Akteuren einerseits und Sterbenden andererseits. Während Sterbende in unserer Studie ihr Sterben als bedrohliche Diskontinuität erleben, erleben die professionellen Akteure Sterben als kontinuierlich erwartbaren Verlauf. Die Konsensfiktion des gemeinsamen Erlebens des Sterbens stellt offenbar eine hilfreiche Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit dem Sterben dar, da hiermit die Unversöhnlichkeit zwischen Ideal und Praxis, die Perspektivendifferenzen zwischen Sterbenden und professionellen Akteuren und damit auch das unlösbare Problem der Endlichkeit unsichtbar gehalten werden können. Wer Hospize und Palliativstationen untersucht, sollte mit enormen Freiräumen der Deutungsarbeit rechnen, die dem Sterben Latenz verschaffen.
Schlüsselwörter: Palliative Care · Studies of Death and Dying · "Gutes" Sterben · Systemtheorie · Perspektivendifferenzen
Heft 1 - 2023
Verfestigung von Armut und die zunehmende Bedeutung von Pfadabhängigkeiten im Lebenslauf
Jan Brülle · Markus Gangl
KZfSS 75, 2023: 1-35
Zusammenfassung: Die Ausstiegswahrscheinlichkeit aus relativer Einkommensarmut hat sich in Deutschland seit Mitte der 1990er-Jahre deutlich verringert. Anhand von Daten des SOEP wird diese Entwicklung mithilfe von Ereignisdatenmodellen und einer nichtlinearen Dekompositionsanalyse durch Veränderungen in der Zusammensetzung der von Armut betroffenen Bevölkerung und der veränderten Struktur der Ausstiegsprozesse erklärt. Die zunehmende Anzahl von Alleinlebenden, vor allem aber steigende Arbeitslosigkeitserfahrungen und ein selbstverstärkender Effekt längerer Armutsepisoden erklären empirisch die abnehmenden Ausstiegschancen, sodass die Ergebnisse insgesamt auf die herausragende Relevanz von Pfadabhängigkeiten im Lebenslauf hinweisen. Zudem sind besonders Arbeiterinnen und Arbeiter sowie jüngere Erwachsene von sinkenden Ausstiegswahrscheinlichkeiten betroffen. Es zeigt sich auch, dass die Verfestigung von Armut vor allem für Ostdeutschland charakteristisch ist. Entwicklungen, die einen Trend sinkender Ausstiegschancen in Westdeutschland zum Teil kompensieren – etwa ein gestiegenes Bildungsniveau innerhalb der von Armut betroffenen Bevölkerung – fehlen in Ostdeutschland.
Schlüsselwörter: Armut · Arbeitsmarkt · Haushaltszusammensetzung · Pfadabhängigkeit· Dekompositionsanalyse · Ereignisdatenanalyse
Zusammenhänge zwischen nachbarschaftlicher Wohnumgebung und schulischem Bildungserfolg
Cornelia Gresch · Lars Hoffmann · Georg Lorenz
KZfSS 75, 2023: 37-61
Zusammenfassung: Ob Merkmale der nachbarschaftlichen Wohnumgebung den schulischen Bildungserfolg beeinflussen, wurde in Deutschland bislang kaum untersucht. Epidemische Theorieansätze lassen erwarten, dass Effekte der Wohnumgebung nicht linear sind, sondern erst ab bestimmten Schwellenwerten auftreten. Der Artikel untersucht den Beitrag der Sozialstruktur der Wohnumgebung zur statistischen Erklärung schulischer Kompetenzen. Dabei wird im Gegensatz zu bereits vorliegenden Arbeiten die Konfundierung von Nachbarschaftsmerkmalen mit individuellen, familiären und schulischen Merkmalen berücksichtigt. Als Datengrundlage dienen die querschnittlichen IQB-Bildungstrendstudien 2015 (N = 1467, 9. Klassenstufe) und 2016 (N = 1546, 4. Klassenstufe), die an sozialräumliche Daten des Statistischen Landesamts Bremen gekoppelt werden. Mehrebenenmodelle weisen auf einen Zusammenhang zwischen der sozialen Zusammensetzung der Nachbarschaft und den schulischen Kompetenzen von Heranwachsenden hin, der weitgehend auf die Konfundierung mit individuellen, familiären und schulischen Merkmalen zurückgeführt werden kann. Die Zusammenhänge sind linear und die Effektstärken fallen für beide Jahrgangsstufen ähnlich klein aus. Die Ergebnisse werden mit Blick auf die Folgen sozialräumlicher Segregation für Bildungsungleichheit diskutiert.
Schlüsselwörter: Nachbarschaft · Wohnumfeld · Segregation · Schulkontext · Bildungsungleichheit
Die Rolle von Werten als Mediator in den Beziehungen zwischen sozialer Stellung und kultureller Omnivorizität in Deutschland
Yevhen Voronin
KZfSS 75, 2023: 63-89
Zusammenfassung: Die Forschung zur kulturellen Omnivorizität – ein Konzept, das ursprünglich als die Fähigkeit zur Erweiterung der eigenen kulturellen Präferenzen konzipiert wurde – gewinnt in Studien zur kulturellen Dimension der sozialen Schichtung immer mehr an Bedeutung. Angesichts der jüngsten widersprüchlichen empirischen Befunde kehrt diese Studie zu den Ursprüngen des Konzepts zurück und untersucht die Rolle von Werten bei der Entwicklung eines omnivoren kulturellen Geschmacks. Am Beispiel Deutschlands und basierend auf den Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS/GGSS) 2014 wurde der indirekte Effekt der sozialen Position auf kulturelle Omnivorizität über postmaterialistische Werte mittels Strukturgleichungsmodellierung empirisch untersucht. Die Ergebnisse legen nahe, dass postmaterialistische Werte als Mediatoren angesehen werden können; eine höhere Position in der sozialen Struktur implizierte eine höhere Wahrscheinlichkeit, postmaterialistische Werte verinnerlicht zu haben, was zu einer höheren kulturellen Omnivorizität führt. Die Indikatoren der sozialen Position wurden ebenfalls getrennt analysiert, wobei sich herausstellte, dass die Erklärungskraft des Bildungsniveaus bei der Vorhersage von kultureller Omnivorizität in etwa die gleiche war wie bei den beruflichen Merkmalen. Der Anteil der Werte, die in Modellen mit Bildung oder beruflichen Merkmalen als Prädiktoren für kulturelle Omnivorizität vermittelt wurden, unterschied sich nicht signifikant.
Schlüsselwörter: Kultursoziologie · Musikgeschmack · Postmaterialistische Werte · SEM · Meditationsanalyse